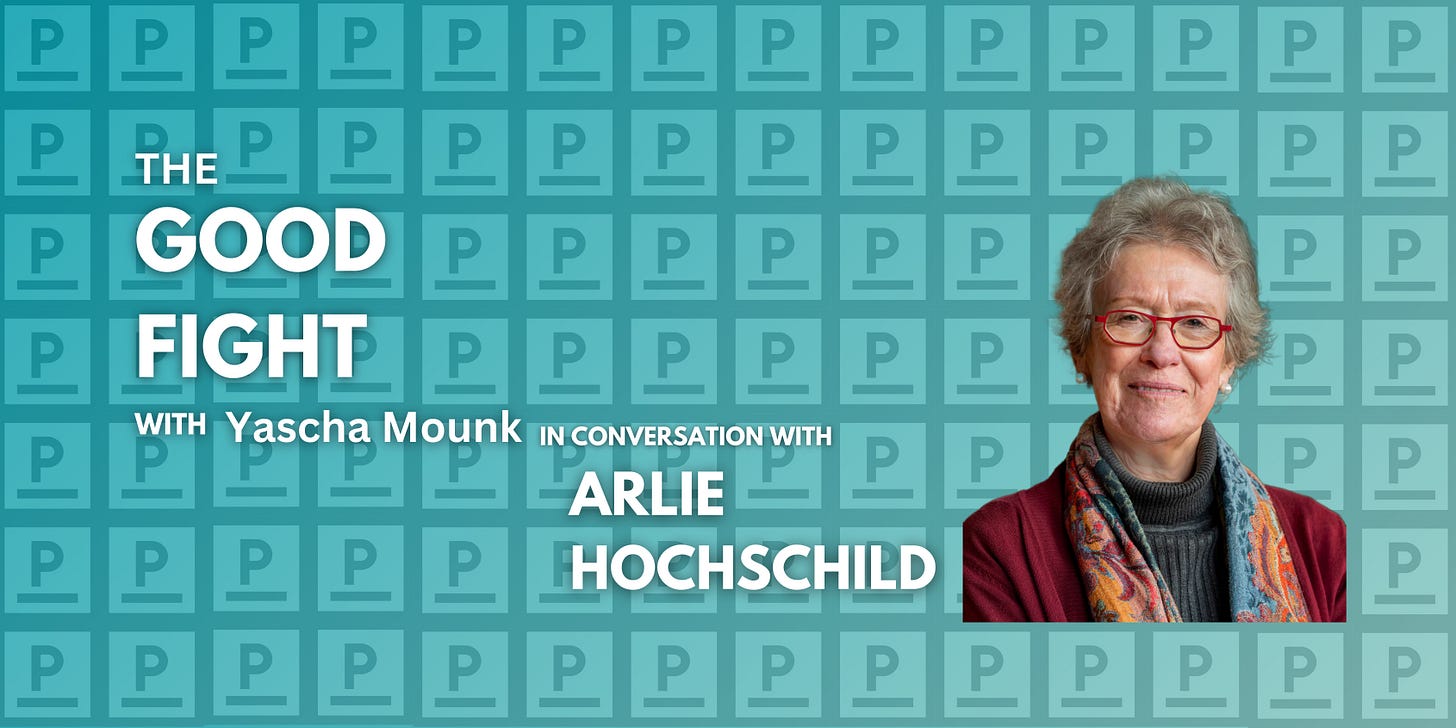Arlie Hochschild über Trump-Wähler, Alt und Neu
Diese Woche habe ich ein weiteres Podcast-Transkript für Sie. Wie immer können Sie meinen Podcast "The Good Fight" auch auf Englisch nachhören. Den Podcast finden Sie auf allen gängigen Plattformen. Abonnieren Sie ihn, um keine Folge zu verpassen.
Arlie Hochschild ist Autorin und emeritierte Professorin für Soziologie an der University of California, Berkeley. Zu ihren Büchern gehören Stolen Pride: Loss, Shame, and the Rise of the Right sowie Strangers in Their Own Land: Anger and Mourning on the American Right (auf Deutsch erschienen als Fremd in ihrem Land: Eine Reise ins Herz der amerikanischen Rechten).
In diesem Gespräch sprechen Yascha Mounk und Arlie Hochschild über die Angst vor Empathie innerhalb der amerikanischen Linken, die Auswirkungen des verlorenen Stolzes in weißen Arbeitergemeinschaften und darüber, wie man die tiefe Geschichte der Latinos verstehen kann, die 2024 für Trump gestimmt haben.
Dieses Transkript wurde zur besseren Verständlichkeit leicht gekürzt.
Yascha Mounk: Sie sind eine Soziologin, die versucht, Amerikaner zu verstehen, indem sie gezielt an bestimmte Orte geht, um sie über lange Zeiträume hinweg und mit großer Tiefe zu studieren. Was, glauben Sie, offenbart diese Methode? Was können wir als Wissenschaftler, Sozialwissenschaftler – und Amerikaner ganz allgemein – lernen, wenn wir uns mit Orten beschäftigen, die normalerweise außerhalb unserer alltäglichen Erfahrungswelt liegen?
Arlie Hochschild: Es ist ein unglaubliches Privileg, tatsächlich in eine kleine Gemeinschaft einzutauchen. Das erste Mal habe ich das im tiefen Süden gemacht, in Lake Charles, Louisiana. Das zweite Mal war ich in Appalachia, in Pikeville, Kentucky. Wenn man wirklich mit den Menschen zusammensitzt, sieht man nicht nur, was sie fühlen, sondern auch die Geschichte dahinter – warum sie so empfinden, wie sie es tun, und welche Umstände sie möglicherweise dafür empfänglich machen, sich jemandem wie Donald Trump zuzuwenden.
Mounk: Ich habe das Gefühl, dass diese Methode Empathie für Menschen schafft, die man sonst vielleicht nur als Gegner oder gar als Feind betrachten würde. Mich beeindruckt immer wieder, dass meine Freunde und Bekannten in linksliberalen Kreisen in den USA eine große Empathie für Menschen in weit entfernten Kulturen aufbringen – selbst wenn diese ganz andere moralische Vorstellungen haben als die meisten ihrer Mitbürger. Sie zeigen Verständnis für traditionelle Gesellschaften in Asien, Afrika oder Südamerika. Doch sobald es um den „näheren Anderen“ geht – also um Menschen in ihrem eigenen Land, die andere wirtschaftspolitische Ansichten haben, die bei Transrechten anderer Meinung sind oder die den amtierenden US-Präsidenten ablehnen –, dann schwindet diese Empathie oft sehr schnell. Sie haben hier eine interessante Perspektive, denn wie Sie in beiden Ihrer letzten Bücher wiederholt betonen, sind Sie selbst eine liberale Universitätsprofessorin aus Berkeley, Kalifornien, und haben tiefgreifende Meinungsverschiedenheiten mit vielen der Menschen, die Sie studieren. Sicherlich mochten Sie nicht jede einzelne Person, mit der Sie in Louisiana oder Kentucky gesprochen haben. Und doch bekommt man das Gefühl, dass Sie mit einem insgesamt positiven Eindruck dieser Gemeinschaften zurückgekehrt sind.
Hochschild: Ich glaube, viele Menschen haben Angst vor Empathie. Empathie ist tatsächlich eine gefährliche Sache. Sie ist nicht nur unerwünscht – sie macht Menschen Angst. Denn wenn man sich in den „Feind“ hineinversetzt, wird man schnell als Komplize gesehen. Das zeigt, wie fragil viele Menschen sich in ihrer eigenen Gruppenzugehörigkeit fühlen. Ich höre oft: „Ich verstehe nicht, warum Sie das tun. Und ich verstehe nicht, wie Sie das aushalten.“ Und genau da hoffe ich, dass meine Bücher etwas bewirken können. Erstens sollen sie wie ein Spiegel für liberale Subkulturen wirken. Zweitens sollen sie dazu einladen, keine Angst davor zu haben, Platz im eigenen Herzen für Menschen zu machen, die ganz anders denken. Jemandem Raum zu geben bedeutet nicht, dass man sich selbst verliert. Meine politischen Überzeugungen haben sich kein bisschen geändert. Ich schreibe meine Bücher, um Menschen „zweisprachig“ zu machen – damit sie verstehen, was auf der anderen Seite vor sich geht.
Mounk: Ich stelle mir vor, dass ein Soziologe oder Anthropologe, der eine sehr traditionelle oder patriarchale Gesellschaft irgendwo im Ausland erforscht, nicht dieselbe Reaktion von Kollegen beim Abendessen bekäme. Niemand würde sagen: „Wie halten Sie das nur aus?“ Vielmehr würden sie fragen: „Wie spannend muss das sein!“ Und doch ist die Reaktion, wenn man eine konservative Gemeinschaft innerhalb der USA besucht, oft: „Mein Gott, das muss ja anstrengend sein, mit diesen Leuten Zeit zu verbringen.“ Das ist sehr aufschlussreich. Ihr letztes Buch basiert auf jahrelanger Forschung in Kentucky, einem der republikanischsten und pro-Trump-orientierten Gebiete des Landes.
Hochschild: Das war nicht immer so, aber heute ist es so. Der Distrikt, den ich besucht habe – KY5 –, ist der weißeste und der zweitärmste Kongressbezirk der USA. Dort habe ich eine Art Mikrokosmos einer nationalen Entwicklung gefunden, die die weiße Arbeiterschicht ohne Hochschulabschluss betrifft. Diese Menschen haben in den letzten zwanzig Jahren massive Verluste erlitten – Einkommen, Eigentum –, und sie zeigen alle sozialen Anzeichen des sozialen Abstiegs. Was wir in Pikeville, Kentucky, in kleinerem Maßstab gesehen haben, ist Teil einer größeren Geschichte. Es sind Menschen, die stolz darauf sind, widerstandsfähig und extrem individualistisch zu sein. Und so habe ich mich auf das konzentriert, was ich das Stolz-Paradoxon nenne.
Früher hatten diese Gemeinschaften gut bezahlte Jobs im Kohlebergbau. Und diese Arbeit war gefährlich, sie fühlten sich wie Kriegshelden – weil sie ihr Leben riskierten. Sie kamen mit der berüchtigten Staublunge zurück, opferten ihre Gesundheit für ihre Familien und ihre Gemeinschaft. All das war eine Quelle des Stolzes. Doch dann – zack – schließen die Minen. Plötzlich sind sie auf sich allein gestellt. Es gibt keine anderen guten Jobs. Einer sagte mir: „Entweder du bleibst hier und machst einen ‘Mädchenjob’ – also eine schlecht bezahlte Dienstleistungsarbeit für Teenager, mit der man keine Familie ernähren kann –, oder du fährst auf der Route 23 nach Norden nach Cincinnati. Aber dann schließen auch dort die Fabriken, und du kommst mit leeren Händen zurück.“ Wir haben es also mit stolzen Menschen zu tun, deren Geschichte aber vor allem von Verlusten geprägt ist. Ich argumentiere in meinem Buch, dass man die Emotionen dieser Menschen verstehen muss. Sie erleben Verlust – und sie haben mit beiden Parteien abgeschlossen. Also wenden sie sich einer Art „Zauberfigur“ zu, einer charismatischen Person. Und wie funktioniert Charisma? Einer sagte mir: „Donald Trump – das ist wie ein Blitz in einer Flasche.“ Es ist eine emotionale Erzählung – und Stolz spielt dabei eine entscheidende Rolle.
Mounk: Eines der Dinge, die mich während Trumps erster Amtszeit wahnsinnig gemacht haben, war die Art und Weise, wie seine Kritiker oft über ihn sprachen. Es gibt viele berechtigte Gründe, ihn zu kritisieren. Doch immer wieder habe ich erlebt, wie Freunde, Kollegen oder Kommentatoren auf CNN und MSNBC ihn auf eine Art attackierten, die übertrieben, aus dem Kontext gerissen oder schlicht unfair war. Und ich dachte mir: Warum? Das macht es seinen Anhängern nur einfacher zu sagen: „Die können keinen Spaß verstehen. Die verdrehen uns jedes Wort im Mund.“
In Ihrem Buch greifen Sie das Stolz-Paradoxon mit einer klassischen sozialwissenschaftlichen Frage auf: Glauben Menschen, dass Erfolg vor allem von individueller Leistung abhängt – oder von äußeren Umständen? Sie zeigen, dass es hier eine klare Trennung gibt: Linke tendieren dazu zu sagen, dass Erfolg von Glück und Struktur abhängt, während Konservative eher an Eigenverantwortung glauben. Ich denke, diese Unterscheidung ist real – aber vielleicht ist sie in der Praxis komplizierter.
Hochschild: Menschen im Herzen von Trumps Amerika sehen sehr wohl die strukturellen Faktoren. Ein Mann, mit dem ich sprach, war ein nachdenklicher, ehemals drogenabhängiger Heroinpatient, der zum Zeitpunkt unseres ersten Treffens obdachlos war. Ich fragte ihn nach Stolz und Scham, und er sagte: „Ein Typ verliert seinen Job in der Mine – zuerst ballt er die Faust gegen den Vorgesetzten. Dann ballt er die Faust gegen den Besitzer der Kohlefirma. Dann ballt er die Faust gegen die Demokratische Partei und gegen Obama, weil der sich für saubere Energie einsetzte.“ Ja, dieser Mann lebte in einer individualistischen Kultur – aber er gab trotzdem zuerst der Struktur die Schuld. Doch das hält nicht lange an. Nach einer Weile denkt er: Es liegt an mir. Und genau in diesem Moment setzt die Scham ein.
Mounk: Ich denke, es gibt zwei mögliche Erklärungen dafür, warum diese Menschen ein so starkes Gefühl der Scham erleben. Die eine Erklärung ist rein strukturell: Sie erleben schlicht und einfach häufiger Ereignisse, die zu Scham führen. Wenn man 1980 in Pikeville, Kentucky, geboren wurde, dann erlebte man eine Kindheit, in der die Kohlejobs noch da waren – und dann verschwanden sie. Die Wahrscheinlichkeit, dass man in eine Lebenssituation gerät, in der man sich als Versager fühlt und die Schuld bei sich selbst sucht, ist daher viel größer als bei jemandem, der in einem wohlhabenden Vorort von New York City aufgewachsen ist, mit all den wirtschaftlichen und bildungspolitischen Möglichkeiten, die dort existieren. Die zweite Erklärung wäre eine kulturelle: Natürlich gibt es in Pikeville, Kentucky, mehr Menschen, die solche existenziellen Erschütterungen erleben, als in Greenwich, Connecticut. Aber nehmen wir an, jemand aus Greenwich, Connecticut hätte trotzdem Pech im Leben – würde das bedeuten, dass er oder sie genauso auf diese Rückschläge reagiert? Oder gibt es eine kulturelle Komponente, die dazu führt, dass Menschen aus diesen beiden Orten auf dieselben Ereignisse ganz unterschiedlich reagieren? Mit anderen Worten: Handelt es sich nur um einen statistischen Effekt – oder gibt es eine tiefere kulturelle Dimension, die die Reaktion auf wirtschaftliche Schocks beeinflusst?
Hochschild: Mein Eindruck ist, dass es mehr als nur ein strukturelles Phänomen ist. Ich glaube, es liegt an der Kultur.
Möchten Sie (oder jemand, den Sie kennen) meine Artikel und Interviews auf Englisch oder Französisch lesen? Abonnieren Sie sich bitte bei meinen entsprechenden Substacks!
Mounk: Wir haben viel über den individuellen Stolz gesprochen, den Stolz auf die eigenen Lebensleistungen, auf den eigenen Status innerhalb eines bestimmten sozialen Kontextes. Sie schreiben darüber, wie Orte wie Pikesville auch die Grundlage für einen Großteil ihres kollektiven Stolzes verloren haben. Früher lieferten sie einen erheblichen Teil der nationalen Kohleproduktion, sie trugen zur wachsenden Wirtschaft bei. Doch die alte Wunde, als Hinterwäldler verspottet zu werden, als einer der ärmeren Teile Amerikas zu gelten, herabgesetzt und belächelt zu werden, schmerzt heute mehr, weil die Gründe für kollektiven Stolz brüchiger geworden sind. Wie ist dieser Wandel passiert?
Hochschild: Ja, kollektiver Stolz ist enorm wichtig. Ich bin froh, dass Sie das ansprechen. Sie haben in ihrem kollektiven Stolz einen schweren Schlag erlitten. Wir haben dafür gesorgt, dass das Licht anbleibt. Wir haben den Ersten und Zweiten Weltkrieg gewonnen. Wir haben das Land versorgt. Das ist ein weiterer Schlag, ein weiterer Verlust. Und hier kommt der nationale Stolz ins Spiel, und Trump passt genau da hinein. Hey, Amerika, wir können andere Menschen oder andere Nationen herabsetzen, weil die Menschen hier geradezu ausgehungert sind nach kollektivem Stolz.
Mounk: Wenn ich über Populismus unterrichte, gibt es in meinem Kurs eine ganze Einheit zu den Wurzeln und Ursprüngen des Populismus. Ich lasse meine Studenten viele Texte aus der Politikwissenschaft, der Soziologie und der Wirtschaftswissenschaften lesen. Einer der Texte, den meine Studenten am überzeugendsten finden – und der auch mich stark beeinflusst hat – ist Ihre Beschreibung dessen, was Sie die „tiefe Geschichte“ nennen.
Hochschild: Ja, eine tiefe Geschichte hat nichts mit dem zu tun, was man sagt, dass man glaubt, oder mit der Parteizugehörigkeit. Es geht darum, wie man sich fühlt. Diese tiefe Geschichte, die sich herauskristallisierte, als ich in Louisiana den Erzählungen der Menschen zuhörte, ist folgende: Du bist ein mittelalter Mann und hast das Gefühl, dass du in einer Warteschlange stehst. Ganz am Ende der Schlange wartet der amerikanische Traum. Er liegt oben auf einem Hügel, du kannst ihn kaum sehen. Und die Schlange bewegt sich nicht. Du bist, so siehst du es, nicht voreingenommen gegenüber anderen, du wartest geduldig. Doch dann gibt es Drängler. Du bist ein weißer Mann, das darfst du nicht vergessen. Eine Frau kommt nach vorne – verdammt, die Hälfte der Bevölkerung sind Frauen, also neue Konkurrenten. Schwarze kommen in die Schlange, Einwanderer, Flüchtlinge, gut bezahlte Beschäftigte im öffentlichen Dienst – alle drängeln sich vor. Und dann schaust du über deine Schulter, und Barack Obama winkt den Dränglern zu.
Dann kommt eine existenzielle Krise. Komme ich aus dieser Schlange überhaupt noch raus? Was passiert hier? Der entscheidende Moment in der tiefen rechten Erzählung ist, dass jemand vor dir in der Schlange, vielleicht mit besserer Bildung, sich umdreht und dich als voreingenommen, rassistisch, sexistisch, homophob und als Hinterwäldler beschimpft. Und dann denkst du: Okay, jetzt reicht es. Ich wurde auf zwei Weisen beschämt – ich wurde zurückgedrängt und dann auch noch dafür beschimpft, dass ich hinten stehe. Und dann taucht ein charismatischer Anführer auf, der dir das Gefühl gibt, dich aus dieser Situation zu befreien. Das ist die tiefe rechte Geschichte.
Dann sagte mir eine Frau: Nein, Sie haben es ein bisschen falsch verstanden. Eigentlich ist es so, dass die Menschen, die in der Schlange warten, die Steuern gezahlt haben, von denen die Drängler nun profitieren. Und eine andere Frau sagte: Wir sind einfach dabei, erfolgreich zu sein. Das waren die Erzählungen, auf die die Menschen in meinem zweiten Buch „Stolen Pride“ reagierten. Ein Mann, der mein erstes Buch gelesen hatte, sagte: Nein, das ist nicht ganz richtig, das ist nicht mehr aktuell. Wir stehen immer noch in der Schlange, aber da ist jetzt ein Tyrann in der Schlange, der uns zurückhält und den Dränglern hilft. Das ist der böse Tyrann. Für sie war das Barack Obama, der in dieser Kohleregion saubere Energie forderte. Aber dann gibt es auch einen guten Tyrannen in der Schlange. Sie wissen vielleicht, dass er kein wirklich netter Mensch ist, dass er sich nicht an die Regeln hält. Sie bewundern sein Privatleben nicht, aber er ist ihr Tyrann. Das ist die Aktualisierung der tiefen Geschichte – und die Gefahr für die Demokratie.
Mounk: Das ist eine hilfreiche Ergänzung, weil sie erklärt, warum intelligente, nachdenkliche und anständige Menschen Donald Trump unterstützen können. Vielleicht gibt es ein paar Menschen, die sich einfach von ihm blenden ließen und ihn wirklich für den großartigsten Menschen halten, der nie etwas falsch gemacht hat – ich denke, diese Menschen existieren eher in der Vorstellung von Liberalen als in der konservativen Realität. Aber diese Geschichte gibt eine Erklärung dafür, warum jemand sich trotzdem für ihn entscheiden könnte.
Hochschild: Er wirkt wie der Robin Hood des gestohlenen Stolzes. In gewisser Weise ist er der gute Tyrann. Und ich glaube wirklich, dass gestohlener Stolz die vorherrschende rechte Erzählung ist – die Wahl wurde gestohlen, unsere Jobs wurden gestohlen. Wenn du das Gefühl hast, dass dieser Robin Hood dir deinen Stolz zurückbringt, dann soll er ruhig anderen etwas wegnehmen, um ihn zurückzuholen.
Mounk: Eine der zentralen Geschichten der Wahl 2024 ist der massive Umschwung hin zu Donald Trump in vielen Minderheitengemeinschaften, darunter Afroamerikaner, indigene Amerikaner und asiatische Amerikaner – aber besonders unter Latinos. Und es scheint mir, dass die tiefe Geschichte, die Sie erzählen, nicht ganz auf diesen Teil der Wählerschaft zu passen scheint. Erstens gehören viele der Menschen, die für Trump stimmen, in dieser Metapher eigentlich zu denen, die sich angeblich in die Warteschlange vordrängen. Zweitens ist das ein Teil der amerikanischen Wählerschaft, für den sich die Schlange oft tatsächlich bewegt hat. Nicht weil sie so viel privilegierter wären als weiße Amerikaner, sondern weil sie vielleicht eingewandert sind oder Eltern haben, die aus sehr armen Gesellschaften eingewandert sind. Sie könnten ihr Leben in Amerika auf der untersten Sprosse der sozialen Leiter begonnen haben, vielleicht weil sie noch kein Englisch sprachen. Und nun haben viele von ihnen Associate Degrees, Bachelor-Abschlüsse, vielleicht Master- oder Berufsabschlüsse und stehen wirtschaftlich deutlich besser da als ihre Eltern oder Großeltern. Die Vorstellung, dass sie sich irgendwie am Ende der Schlange festgefahren fühlen, scheint auf einige von ihnen nicht zuzutreffen. Wie sollten wir über das sehr unterschiedliche demografische Muster der Trump-Unterstützung im Jahr 2024 nachdenken, im Vergleich zu 2016?
Hochschild: Ich denke, es gab in dem Gebiet, auf das ich mich konzentriert habe, drei Arten von Wählern. Die erste Gruppe bestand aus den wahren MAGA-Verfechter, die das Gefühl hatten, dass Trump ihr Robin Hood für den gestohlenen Stolz sei. Die zweite Gruppe bestand aus Pragmatikern, die sagten: Es ist für mich nützlich, für einen Typen wie den zu stimmen. Ich bin ziemlich kritisch ihm gegenüber, aber hey, vielleicht kann er meiner Gruppe helfen. Und die dritte Kategorie waren die demokratischen Aussteiger – Menschen, die den politischen Prozess insgesamt aufgegeben hatten. Meine Überlegungen bezogen sich auf die erste Gruppe. Aber ich denke, es gibt viele Pragmatiker, und ich würde vermuten, dass viele der lateinamerikanischen Trump-Wähler sagen würden: Da ist etwas für mich drin. Ich steige in diesen Zug ein.
Mounk: Jeder Teil dieses Puzzles ist wichtig zu erklären. Aber es kommt mir so vor, als müssten wir uns für viele Zwecke besonders um eine Erklärung für die anderen Gruppen bemühen. Ich hatte während der ersten Trump-Präsidentschaft immer den Eindruck, dass wir viel zu viel darüber nachgedacht haben, wie wir die eingefleischten MAGA-Anhänger dazu bringen können, ihre Meinung zu ändern. Denn mir schien immer, dass genau das nicht der Grund war, warum er gewinnt.
Was ihn gewinnen lässt, ist, dass viele Menschen, die keine überzeugten Anhänger sind, bereit sind, für ihn zu stimmen oder ihn zumindest in Kauf zu nehmen.
Hochschild: Die Demokraten sprechen nicht über soziale Klassen, sie sprechen über Identitätsgruppen. Wir haben dieses narrative Aufstiegsversprechen verloren, das Menschen das Gefühl gibt, dass ihre harte Arbeit anerkannt wird. Viele denken sich: „Schaut her, es war schwer. Ich hatte eine harte Zeit. Erzählt mir nicht, dass ihr die Partei der Mittelschicht seid. Wie kommt man überhaupt in die Mittelschicht?“ Menschen, die sich mühsam wieder nach oben kämpfen, fühlen keine „Freude“ – sie fühlten sich ausgeschlossen aus der Erzählung der Demokraten.
Was jetzt passiert ist, denke ich, ist, dass wir auf der einen Seite eine politische Partei haben, die Demokratische Partei, die keine Bewegung hat, keine Bewegungspersönlichkeiten hat und sich selbst auch nicht als Bewegung begreift. Und auf der anderen Seite haben wir eine Bewegung. Es ist also eine Partei gegen eine Bewegung. Und auf der demokratischen Seite suchen wir nach Führungspersönlichkeiten.
Mounk: Es ist eindeutig so, dass sich der Schwerpunkt der Politik – nicht nur in den USA, sondern in weiten Teilen der westlichen Welt – von wirtschaftlichen Fragen hin zu kulturellen Themen verlagert hat. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand bisher eine wirklich überzeugende Erklärung dafür geliefert hat, warum das so ist.
Ich stimme Ihnen auch in vielen Punkten zur Demokratischen Partei zu – etwa dass viel über Freude geredet wurde, aber unklar war, ob diese Freude überhaupt authentisch oder weit verbreitet war. Aber ich frage mich, ob die Wähler nicht nur einfach wenig Begeisterung für die Demokratische Partei empfanden – was ja offensichtlich sein muss, wenn sie letztendlich für Trump gestimmt haben –, sondern ob sie sich auch regelrecht im Stich gelassen fühlten, ob es also nicht nur ein Mangel an Begeisterung war, sondern eine aktiv negative Wahrnehmung.
Ich frage mich auch, ob die beiden Teile der Trump-Wählerschaft nicht emotional sehr unterschiedlich sind. Es ist nachvollziehbar, dass sich die Menschen in Pikesville so fühlen, als stünden sie ganz hinten in der Warteschlange. Aber vielleicht ist der durchschnittliche Trump-Wähler in Miami ganz anders. Vielleicht denkt er: „Mein Leben geht voran. Ich bin wohlhabender als meine Eltern es waren, habe mehr Chancen als sie. Ich bin ein stolzer Amerikaner geworden. Ich fühle mich in diesem Land sicher und zugehörig. Ich fühle mich nicht von Trumps Witzen über Einwanderer oder andere Gruppen bedroht. Ich denke nicht, dass er über Menschen wie mich spricht, wenn er so redet. Tatsächlich sind es die Demokraten, die keinen Glauben an wirtschaftliches Wachstum haben, keinen Glauben an meine Fähigkeiten.“
Ich frage mich, ob die tiefe Geschichte nicht viel grundlegender unterschiedlich ist – ob sie nicht in einer aufstrebenden Vision von Amerika und der eigenen Rolle darin verwurzelt ist.
Hochschild: Die tiefe Geschichte und das Bild der Warteschlange beziehen sich auf das Gefühl, festzustecken und zurückgedrängt zu werden. Und was Sie andeuten, ist, dass ein Teil der Latino-Wählerschaft – und ich habe auch mit Taxifahrern gesprochen, die meinten: „Der Typ Trump ist gar nicht so übel, vielleicht könnte ich auf seinen Zug aufspringen“ – eine ganz andere Perspektive hat.
Die Demokratische Partei hat es versäumt, einen überzeugenden Appell an die soziale Aufstiegsmobilität zu richten. Tatsächlich zeigen Studien über Optimismus, dass Schwarze, selbst wenn sie wirtschaftlich schlechter dastehen, oft optimistischer sind als Weiße in vergleichbaren wirtschaftlichen Verhältnissen. Und wir müssen uns fragen: Warum haben die Demokraten das nicht für sich genutzt? Schließlich ist genau das der klassische amerikanische Traum.
Hier scheint auf der Seite der Demokraten eine erzählerische Leerstelle zu existieren. Gewerkschaften haben früher eine große Rolle gespielt – sie vermittelten eine Geschichte von Aufstieg und Fortschritt. Aber ich denke, dass die Globalisierung den Gewerkschaften stark geschadet hat. Die Fabriken, die einst die Interessen der Arbeiter verteidigten, wurden ins Ausland verlagert oder durch Automatisierung überflüssig gemacht. Wir brauchen ein neues Konzept dafür, welche Strukturen diese Erzählung künftig tragen sollen – und diese Erzählung muss Optimismus enthalten.
Mounk: Können Sie erklären, was die liberale tiefe Geschichte ist?
Hochschild: Die liberale tiefe Geschichte besagt, dass wir nicht in einer Warteschlange stehen, sondern alle in einem Kreis um einen öffentlichen Platz versammelt sind. In der Mitte dieses Platzes steht ein hochmodernes, kreatives, öffentlich finanziertes Wissenschaftsmuseum für Kinder. Und die Menschen in diesem Kreis denken sich: „Ich habe Steuern dafür gezahlt und bin stolz darauf. Ich liebe die Vorstellung, dass ein Kind, egal aus welcher sozialen Klasse oder welchem ethnischen Hintergrund, dieses Museum besuchen und etwas über Wissenschaft lernen kann.“ Oder sie denken: „Ich habe dieses Museum entworfen. Ich bin wirklich stolz darauf.“ Sie fühlen sich als Teil eines öffentlichen Raums, auf den sie stolz sind. Tatsächlich brauchen wir mehr Wissenschaftsmuseen. Wir sollten im ganzen Land weitere solcher Museen bauen.
Dann, in einem weiteren Moment dieser liberalen tiefen Geschichte, taucht ein Mann mit einem großen Bagger auf. Er sitzt in dieser massiven Maschine, fährt in den öffentlichen Platz hinein und beginnt, die Fundamente des Kindermuseums herauszureißen. Er nimmt das Baumaterial und verwendet es, um eine protzige Luxusvilla für das reichste eine Prozent der Gesellschaft zu bauen.
Die Menschen, die im Kreis um den öffentlichen Platz stehen, sind wütend. „Wir haben dieses wunderbare, für alle zugängliche Projekt geschaffen – und jetzt kommt jemand und reißt es einfach ab, verkleinert diesen öffentlichen Raum nur zu seinem eigenen privaten Vorteil.“ Das ist eine andere Art von Diebstahl.
Mounk: Ich frage mich, ob es nicht eine kulturelle Version der liberalen Erzählung gibt, die der ursprünglichen tiefen Geschichte, die Sie für die Rechte beschrieben haben, vielleicht ähnlicher ist. In dieser Version sind die Tore weit geöffnet. Wenn man die richtigen Dinge tut, kann man durch die Tore gehen. Man muss nur studieren, die richtigen Werte haben, und man wird aufgenommen.
Aber die Wächter dieses Museums sind gehässig und voreingenommen. Sie wollen keine Frauen, keine ethnischen Minderheiten oder andere Menschen, die ein wenig anders sind, hineinlassen. Gleichzeitig gibt es einige weiße Menschen, die ebenfalls nicht hineingelassen wurden – aber sie machen sich nicht einmal die Mühe, sich auf den Weg zum Tor zu machen. Stattdessen sitzen sie träge herum oder schikanieren die Minderheiten, die versuchen, hineinzukommen. Sie sind nicht drinnen, weil sie diese Entscheidung selbst getroffen haben. Wäre das eine unfaire Beschreibung – vielleicht nicht der liberalen tiefen Geschichte, aber der progressiven tiefen Geschichte?
Hochschild: Ich bin mir nicht sicher, ob das die liberale tiefe Geschichte ist. Das Bild eines Kreises unterscheidet sich hier etwas von der Metapher der Warteschlange. Man kann den Kreis erweitern – wenn sich diese Minderheitengruppe anschließt und jene Minderheitengruppe ebenfalls, dann wird der Kreis größer. Aber der Glaube an öffentliche Güter, die allen zugutekommen, steht dabei im Mittelpunkt.
Was beim Nachdenken über tiefe Geschichten wichtig ist, ist, dass man sich der Emotionen bewusster wird, die mit ihnen verbunden sind und die sie hervorrufen – sodass sie einen weniger überraschen. Genau deshalb sind Geschichten so bedeutsam.
Falls Sie meinen Podcast “The Good Fight” (auf Englisch) noch nicht abonniert haben, tun Sie das jetzt!
Dieses Transkript wurde mit Hilfe von KI übersetzt und von Niya Krasteva redigiert.